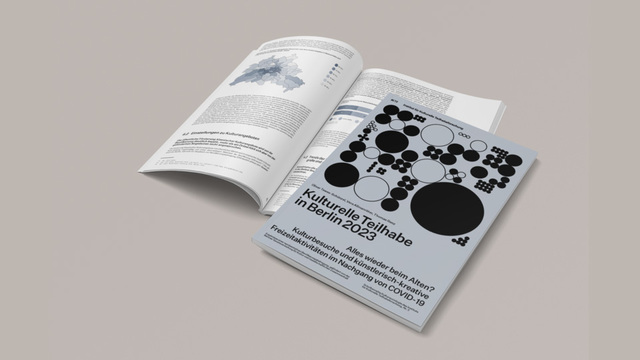.jpg)
Foto: Institut für Kulturelle Teilhabeforschung (IKTf)
Kulturelle Teilhabe im Museum
Viel Potenzial – aber eine große Aufgabe!
Von:
Sabine Fauland (Museumsbund Österreich), Thomas Renz (wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Kulturelle Teilhabeforschung (IKTf)), Graz/Wien/Berlin
Das Institut für Kulturelle Teilhabeforschung (IKTf) erforscht, welche Bedingungen Kulturelle Teilhabe begünstigen oder verhindern. Im Juni erschien eine Studie zur Kulturellen Teilhabe in Berlin, bereits die dritte repräsentative Bevölkerungsbefragung zur Kulturellen Teilhabe in Berlin. Diese Gelegenheit haben wir genutzt, um uns über das Museumspublikum mit Thomas Renz zu unterhalten.
Sabine Fauland (SF): Es ist ein Dauerbrenner in Studien zur kulturellen Beteiligung – Menschen mit formal höheren Bildungsabschluss zählen zu den häufigsten Besucher:innen von kulturellen Veranstaltungen. Schon in einem österreichischen nationalen Kulturbericht aus 1975 wurde das festgestellt. Haben Sie nach all Ihren Erfahrungen mit Studien, auch hinsichtlich Nicht-Besucher:innenforschung, das Gefühl, dass sich das jemals ändern wird? Bleibt das Museum ein elitärer Ort?
Thomas Renz (TR): Aus den 1970er-Jahren gibt es die ersten aussagekräftigen Studien zum Museumspublikum. Im Großen und Ganzen haben Museumsbesucher:innen – trotz der Bildungsexpansion – formal immer noch einen überdurchschnittlich hohen Bildungsabschluss. Trotz der vielen positiven Veränderungen, wie der Gedanke „Bildung für alle“, und der Bemühungen um ein Öffnen für Besucher:innen, die nicht zum sog. klassischen Kulturpublikum zählen. Wir am Institut für Kulturelle Teilhabeforschung (IKTf) gehen auch nicht mehr von einem Kultur- oder Museumspublikum aus, sondern differenzieren stärker. Wir haben einen Datensatz von ca. 0,5 Mio. Interviews! Es gibt starke Unterschiede zwischen den Museumstypen, aber auch welches Publikum ein bestimmtes Museum anspricht. Die Bemühungen um Besucher:innen haben Erfolg! Um bei konkreten Beispielen zu bleiben: Was den formalen Bildungsabschluss betrifft, so ist das Publikum von Kunstmuseen und verwandten Institutionen am elitärsten. Am diversesten sind Technik- oder Freilichtmuseen. Es ist eben auch eine Frage des Inhalts und der Formate. Gerade bei Freilichtmuseen wird deutlich, dass es ein anderes Rezipieren ist: locker, luftig, Sitzmöglichkeiten, mitgebrachte Speisen können verzehrt werden. Das ist eine ganz andere Atmosphäre als eine klassische Ausstellung zeitgenössischer Kunst oder Alter Meister.
SF: Möglicherweise gänzlich ohne oder mit spärlichen, unbequemen Sitzmöglichkeiten! Das Elitäre ist schon in der Institutionengeschichte eingeschrieben. Das British Museum gilt als erstes öffentliches Museum und dennoch musste man sich für den Besuch formell anmelden und vor allem adäquat gekleidet sein. Von vornherein ist so der überwiegende Teil der Bevölkerung ausgeschlossen.
TR: Das trifft auch auf Theater zu! Die Hausordnung der Staatsoper in Wien sieht vor, Personen, die nicht dem Anlass entsprechend gekleidet sind, den Zugang verwehren zu können. Das unterstützt ein bestimmtes Image!
SF: Die Folgen der Pandemie sind nicht nur gesellschaftspolitischer Natur, der Konsum kultureller Veranstaltungen hat sich verändert. Ihre Kollegin Vera Allmanritter sprach von „kultureller Entwöhnung“ bei klassischen Angeboten. Was müssen wir verändern: Müssen wir unseren Kulturbegriff deutlich erweitern oder müssen sich die Kulturbetriebe an neue, andere Publikumserwartungen anpassen?
TR: Wir führen alle zwei Jahre eine Bevölkerungsbefragung in Berlin durch, deren Ergebnisse sich durchaus auf andere Orte übertragen lassen. Die Top-3-Barrieren, auch in vielen anderen Nicht-Besucher:innen-Studien, warum das Kulturangebot nicht wahrgenommen wird, waren vor der Pandemie: zu teuer, kein passendes Angebot, keine Zeit. 2023 sind diese Barrieren immer noch relevant, aber es kommt eine neue dazu: die Menschen haben sich daran gewöhnt, zuhause zu sein! Dort bekommen die Menschen weniger mit. Es fehlt auch ein wichtiger Informationsfluss, Empfehlungen von Freunden und Bekannten, die ebenfalls mehr zuhause sind. Den Kulturbegriff zu erweitern, ist eine leichte Übung, aber keine Lösung. Der sehr weite Kulturbegriff der UNESCO ist operativ nicht handhabbar. Wir haben bereits einen weiten Kulturbegriff und trotz öffentlicher Förderung möglicherweise in Zukunft leere Kultureinrichtungen. Letztendlich müssen die Museen und vorgelagert die Kulturpolitik Lösungen entwickeln, damit die Leute wieder- und vermehrt kommen.
SF: In einer Nicht-Besucher:innenstudie für das Landesmuseum Burgenland kam klar heraus, nur weil das Museum nicht besucht wird, ist es den Menschen trotzdem wichtig. Oder ist es einfach sozial erwünscht, zu sagen, dass Museen wichtig sind und nicht zugesperrt werden dürfen.
TR: Ja, das ist bemerkenswert. Während der Pandemie haben wir gefragt, ob die Förderung von Kunst und Kultur sowie von Küstler:innen unterstützt wird, der Großteil der Bevölkerung hat immer die höchste Zustimmung erteilt. Gleichzeitig wissen wir, dass die Nutzung, die Besuche, wesentlich sind. Ganz wertfrei zeigt es, dass Kultur ein positives Image hat. Man kann es auch bisschen kritischer interpretieren: Kulturförderung könnte auch in Frage gestellt werden, wie auch zurzeit die Förderung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten von bestimmten politischen Richtungen in Frage gestellt wird. Hier geht es nicht nur um Geld, sondern auch um Inhalte! Solche Diskurse können auch in den Kulturbereich schwappen! Wenn gerechnet wird, mit wie viel Geld viele Tickets subventioniert werden … Das ist schon eine Herausforderung.
SF: Kürzlich hat das Institut für Museumsforschung eine Studie veröffentlicht, in der festgeschrieben wird, wie hoch das Vertrauen der Bevölkerung in die Institution Museum ist. Museen könnten also bildungs- und demokratiepolitisch relevante Arbeit leisten!
TR: Ja, da steckt schon viel Potenzial drin! Aber es ist auch eine große Aufgabe. Die Ausgangslage ist jedenfalls positiv, ob der Museums- und Kulturbereich das auf Dauer einlösen kann, wird man sehen. Schließlich werden der Institution Museum sehr viele Aufgaben zugeschrieben, es fehlt sicher an Personal, um nicht nur große Reden zu schwingen, sondern auch Taten zu setzen.
SF: Ein Dauerbrenner: Freier Eintritt erhöht die kulturelle Beteiligung. Realität oder Wunsch?
TR: Eher ein frommer Wunsch, die Realität ist leider immer komplexer. In Berlin gibt es den eintrittsfreien Museumssonntag (www.museumssonntag.berlin), der Senator für Kultur subventioniert das entstehende Defizit, das ist ein ordentlicher Betrag! Wir haben die ersten Museumssonntage mit Befragungen begleitet. Das Publikum ist an den Museumssonntagen lokaler, studentischer, diverser, jünger. Zu einer spezifischen Steigerung an Besuchen von statistisch finanziell vulnerablen Gruppen führte die Aktion nicht. Auch der Bildungsabschluss der Besucher:innen war durchwegs formal hoch. Freier Eintritt muss begleitet sein von einer Kommunikationskampagne und von einem Rahmenprogramm. Es muss die Atmosphäre eines Tags der offenen Tür herrschen. Ich hatte auch den Eindruck, dass manche den Museumssonntag auch nutzten, um mehrere Museen kürzer zu besuchen.
SF: Und nun ein Dauerbrenner, der mich besonders beschäftigt: Was ist Ihre Einschätzung – warum gibt es so wenig Publikumsforschung in Museen? Was fehlt? Motivation, Geld, Know-how?
TR: Verglichen mit der Theaterlandschaft ist es gar nicht so dramatisch. Es werden Besucher:innenbefragungen gemacht, aber oft sind es einmalige Ereignisse, es gibt keine Vergleichsdaten. So lange die Auslastungszahlen für die Kulturpolitik stimmen, ist die Motivation auch nicht so groß, das Publikum zu befragen. Dass es verschiedene Rezeptionstypen gibt, wundert viele Wissenschafter:innen und Kurator:innen noch immer! Viele Museumsdirektor:innen haben jedoch inzwischen Ausbildungen im Kulturmanagementbereich und sind an Publikumsforschung interessiert.
SF: Haben Sie einen Tipp aus Ihrer persönlichen Schatzkiste, wie gerade junges Publikum vermehrt begeistert werden kann
TR: Den Tipp, mit dem man mit wenig Aufwand und wenig Veränderungen in den Strukturen viele neue junge Leute kriegt, den gibt es nicht. Zu glauben, dass Kampagnen in Sozialen Medien ausreichen, um junge Menschen ins Museum zu locken, haben keine Kausalität. Es kommt also darauf an, was ich ihnen anbiete, Inhalte, die an ihren Lebensalltag anschließen, bspw. machen sich viele Jugendliche Sorgen um die Spaltung der Gesellschaft. Die Aufgabe besteht also darin, in den Sammlungen Anschlussstellen an dieses Thema zu finden. Eine zweite Strategie sind Formate. Ältere Museumsbesucher:innen sind zufrieden mit dem Status Quo, aber jüngere wünschen sich explizit mehr Partizipation. Man muss sich also fragen, was es bedeutet, Jugendliche an Ausstellungsarbeit zu beteiligen, Macht abzugeben. Denn es geht um die Macht über Entscheidungen, Deutung und Bewertungen. Das ist ein durchaus schmerzhafter Prozess. Wenn wir diese Veränderung vollziehen, haben wir am Ende ein anderes Museum.
Thomas Renz ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Kulturelle Teilhabeforschung (IKTf) Berlin (www.iktf.berlin). Das Gespräch führte Sabine Fauland, Geschäftsführung, Museumsbund Österreich, Graz/Wien.
Credits und Zusatzinfos:
Empfohlene Zitierweise
Empfohlene Zitierweise
Sabine Fauland, Thomas Renz: Kulturelle Teilhabe im Museum. Viel Potenzial – aber eine große Aufgabe!, in: neues museum 24/4, www.doi.org/10.58865/13.14/244/2.








