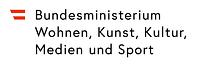Der freie Eintritt ist nicht die Lösung – aber ein sehr wichtiger Schritt
Von:
Sabine Fauland (Museumsbund Österreich), Graz/Wien
Seit der Wiedereröffnung 2023 ist der Eintritt in die Dauerausstellung des Wien Museums kostenlos – ein kulturpolitischer Meilenstein mit deutlicher Wirkung: Die Besucher:innenzahlen haben sich verfünffacht, das Publikum ist vielfältiger geworden. Mit dem Gratiseintritt allein ist es nicht getan. Matti Bunzl, Direktor, und Nathaniel Prottas, Leiter der Vermittlung, zeigen, warum der Weg zu einem offenen, inklusiven und demokratischen Museum weit mehr verlangt – und welche Rolle dabei Kinder, Schulklassen und ein Wal aus Kupferblech spielen.
Sabine Fauland (SF): Der freie Eintritt ins Wien Museum ist ein starkes Signal. Wie verändert der kostenlose Zugang das Publikum – und vielleicht auch die Haltung des Museums zu seinen Besucher:innen?
Matti Bunzl (MB): Es ist ein starkes Signal! Gerade in einem musealen Kontext, in dem das noch nicht selbstverständlich ist. Uns hat das britische System inspiriert – dort ist der freie Zugang zu den Sammlungen schon lange etabliert. Seit ich das in Großbritannien erlebt habe, war für mich klar: Das ist das Modell, wie ich mir ein Museum vorstelle. Die Sammlungen gehören der Öffentlichkeit – sie sollten auch ohne Hürde zugänglich sein. Dass man für Sonderausstellungen, die mit Leihgaben anderer Institutionen arbeiten, Eintritt verlangt, finde ich nachvollziehbar. Aber der freie Eintritt zur Sammlung öffnet das Haus. Man sieht sofort: Die Besucher:innen kommen in viel größerer Zahl und Vielfalt. Je weniger Hürden – und Geld ist eine große –, desto breiter das Publikum. Natürlich muss man die Menschen auch aktiv einladen und ihnen zu verstehen geben, dass sie willkommen sind. Das ist ein Prozess, der viel, viel leichter ist, wenn das Museum gratis ist. Das ist nicht die Lösung, aber es ist ein sehr wichtiger Schritt.
Nathaniel Prottas (NP): Genau. Es war ein wichtiger Schritt, aber kein isolierter. Wir haben parallel daran gearbeitet, das gesamte Programm zugänglicher zu machen: sprachlich, inhaltlich, und wir haben Outreach-Formate etabliert. Der freie Eintritt allein reicht nicht, aber er erleichtert es enorm, Menschen einzuladen, die sonst vielleicht gar nicht kommen würden. Es ist toll, wenn man den Menschen ein ganzes Haus zur Verfügung stellen kann, damit sie lernen können, es für sich zu nutzen.
SF: Der Eintrittspreis ist ja nicht die einzige Hürde. Viele Menschen wissen gar nicht, was sie in einem Museum erwartet.
MB: Ja, und genau da beginnt ein Kulturwandel. Wenn der Eintritt frei ist, kann ich auch mal nur kurz reinschauen – das nimmt den Druck raus. In Museen mit Eintritt versuchen viele, möglichst „alles“ in einem Besuch zu sehen. Und das ist unmöglich. Entweder ist man hinterher völlig erschöpft oder frustriert, weil man nicht alles geschafft hat. Beides erzeugt kein gutes Gefühl.
SF: Wird der freie Eintritt langfristig gesichert sein? Welche politischen oder finanziellen Herausforderungen sind damit verbunden?
MB: Wir hoffen sehr, dass er bleibt. Wir sind Teil einer Stadt, in der „Kultur für alle“ ein erklärtes Ziel der Politik ist. Die politischen Entscheidungsträger stehen hinter uns, das ist essenziell. Natürlich kann sich das mit anderen Mehrheiten ändern. Aber was wir tun können, ist: zeigen, dass das funktioniert – und zwar hervorragend. Vor dem Umbau hatten wir jährlich rund 130.000 Besucher:innen. Jetzt sind es 650.000. Eine Verfünffachung! Diese Zahlen sprechen für sich.
SF: Wie erreicht ihr bildungsferne Gruppen, die klassisch nicht zum Museumspublikum gehören?
NP: Unsere Schulprogramme spielen eine zentrale Rolle. Die Schulen, die zu uns kommen, kommen aus allen Bezirken – auch aus jenen mit höherem Anteil sozial benachteiligter Familien. Und sie kommen nicht nur, sie kommen gerne. Unsere Programme sind dialogisch, alle dürfen mitreden, niemand bekommt eine „Führung“ im klassischen Sinne. Das verändert die Beziehung zur Institution. Trotzdem müssen wir realistisch bleiben: Der Anteil bildungsferner Gruppen im Museum steigt nicht automatisch. Wir müssen aktiv auf Menschen zugehen. Seit Kurzem kooperieren wir mit der MA17 – Integration und Diversität. Das hilft nicht nur, neue Gruppen einzuladen, sondern auch zu hören, was sie eigentlich brauchen. Ein Beispiel: Bei einer Gesprächsrunde kam das Thema Kinderbetreuung auf. Viele Familien würden gerne kommen, aber wenn sie ihre Kinder nicht betreut wissen, geht das einfach nicht. Das war ein Aha-Erlebnis.
SF: Eure Dauerausstellung zeigt viele Perspektiven, auch marginalisierte. Wie habt ihr das kuratorisch gelöst, trotz einer Sammlung, die vielleicht klassische Hierarchien abbildet?
MB: Uns ist bewusst, dass museale Sammlungen in der Regel nur einen sehr einseitigen Ausschnitt der Geschichte zeigen – das gilt nicht nur für uns, sondern für die meisten Museen weltweit. Deshalb war es uns wichtig, diese Einseitigkeit offen zu benennen und zu versuchen, die Geschichte möglichst breit und vielstimmig zu erzählen. Unsere Ausstellung entstand über einen langen Zeitraum – wir haben 2016 mit der Konzeption begonnen und 2023 eröffnet. Diese Zeit war entscheidend, um Quellen zu sichten, Erzählstrukturen zu entwickeln und passende mediale Formate zu finden – sei es Grafik, Ton oder Objekt.
NP: Ein großer Vorteil war, dass unsere Vermittlung von Anfang an eingebunden war. Kolleg:innen mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Arbeit mit Publikum konnten wertvolle Hinweise geben: Welche Geschichten fehlen? Worauf reagieren Besucher:innen besonders? Diese enge Zusammenarbeit hat dazu beigetragen, dass wir in jedem Ausstellungskapitel noch einmal kritisch nachgefragt und bewusst Entscheidungen getroffen haben. Sicher gibt es Dinge, die man besser machen könnte – aber wir glauben, dass uns eine dichte, reflektierte und vielschichtige Ausstellung gelungen ist.
MB: Und nicht jede Geschichte lässt sich mit einem Objekt erzählen. Aber mit Sound, Grafik, Sprache kann man viel sichtbar machen. Unser Ziel war: eine Vielzahl an Stimmen hörbar zu machen. Nicht alles ist sichtbar – aber vieles lässt sich andocken. Auch Menschen, die sich nicht direkt wiederfinden, erkennen vielleicht eine Erfahrung, eine Frage, ein Gefühl. Es geht um Beziehung, nicht um Repräsentation im engeren Sinne. Unsere Dauerausstellung bietet viele Möglichkeiten zur Identifikation und zum Anknüpfen – mit Geschichten und Perspektiven unterschiedlichster Gruppen. Natürlich kann nicht jede Geschichte und jede Community vollständig abgebildet werden, das wäre eine überhöhte Erwartung. Aber die Ausstellung ist so vielschichtig konzipiert, dass sie zahlreiche Anknüpfungspunkte bietet: sei es über Themen wie Arbeit, Sprache oder Lebensstil. Auch Menschen, die sich nicht eins zu eins repräsentiert sehen, können sich wiederfinden – auf anderen Ebenen. Die Frage, ob man sich im Museum „selbst wiederfinden“ muss, ist ohnehin komplex. Es ist eine stark identitätsbezogene Vorstellung. In gewisser Weise spiegeln Museen immer auch Allgemeines wider – und manchmal eben auch das ganz Fremde. Und manchmal ist es einfach nur ein faszinierendes Objekt, wie etwa unser Wal Poldi. Solche Objekte können auch verbinden und berühren.
SF: Gibt es Reaktionen auf kontroverse Themen? Führungen zu Gender, Migration – ist das manchmal heikel?
NP: Wir haben das antizipiert, aber es ist tatsächlich selten ein Problem. Die Menschen buchen gezielt Führungen – sie wollen ins Gespräch. Unser Ansatz ist dialogisch, nicht belehrend. Gerade im Schulprogramm feiern wir zum Beispiel Mehrsprachigkeit. 50 % der Kinder in Wien sprechen zu Hause eine andere Sprache – das ist kein Defizit, sondern ein Schatz. Und wenn jemand etwas problematisch formuliert? Unsere Vermittler:innen sind geschult, damit gut umzugehen.
SF: Was bedeutet „demokratische Praxis“ für euch im Kontext eines Museums wie dem Wien Museum?
MB: Demokratie ist ein großer Begriff – aber Museum ist auch Verwaltung, Alltag, Pragmatik. Für mich ist wichtig: respektvoller Umgang, flache Hierarchien, Offenheit. Aber ich hänge das nicht an Begriffen auf.
NP: In der Vermittlung diskutieren wir das durchaus. Was heißt demokratische Arbeit? Wo sind die Grenzen? Mein Eindruck: Viele Museen täuschen sich da etwas vor. Es geht nicht darum, alles abzubilden, sondern darum, Beziehungen aufzubauen. Und vor allem: ehrlich zu sein. Wir sagen nicht „Wir sind divers“, sondern wir versuchen, es zu sein – jeden Tag aufs Neue.
SF: Welche Rolle kann das öffentliche Museum dann in einer demokratischen Gesellschaft spielen?
MB: Für mich hat das Museum eine ähnliche Rolle wie die Schule – ein öffentlicher Ort, an dem wir als Gesellschaft zusammenkommen. Wo man Geschichte verstehen kann – kollektiv und individuell. Wo sich Bürger:innenschaft entwickelt. Dabei behalten wir natürlich die klassischen Aufgaben Sammeln, Bewahren, Forschen, Vermitteln. Aber wir verbinden das mit einem gesellschaftlichen Auftrag.
Credits und Zusatzinfos:
Foto: Ina Aydogan, Wien Museum (1), Nick Mangafas, Wien Museum (2, 3)
Empfohlene Zitierweise
Sabine Fauland im Gespräch mit Matti Bunzl und Nathaniel Prottas: Der freie Eintritt ist nicht die Lösung – aber ein sehr wichtiger Schritt, in: neues museum 25/4, www.doi.org/10.58865/13.14/254/2.
Empfohlene Zitierweise
Sabine Fauland im Gespräch mit Matti Bunzl und Nathaniel Prottas: Der freie Eintritt ist nicht die Lösung – aber ein sehr wichtiger Schritt, in: neues museum 25/4, www.doi.org/10.58865/13.14/254/2.